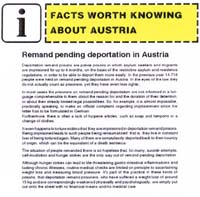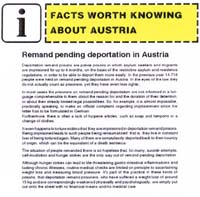In Österreich, Deutschland und anderen
EU-Staaten ist die Zunahme sowohl offensiver als auch subtiler rassistischer
Diskurse und Praktiken in den letzten Jahren unübersehbar geworden.
1997 ist von der EU zum „Europäischen Jahr gegen Rassismus“ erklärt
worden, wobei staatliche Rassismen in diesem Zusammenhang keine bedeutende
Rolle spielten. Der Schwerpunkt wurde in erster Linie auf Fremdenfeindlichkeit
und Rechtsradikalismus gelegt. Auffassungen von Rassismus als Randphänomen
delegieren politische Verantwortung für Rassismen auf einzelne Gruppen
und Personen.
Wenig beachtet sind daher im allgemeinen
rassistische institutionalisierte Praktiken gegenüber MigrantInnen,
Flüchtlingen und Angehörigen von Minderheiten. Oft erregen erst
extreme und gewaltsame rassistische Übergriffe die Aufmerksamkeit
der Öffentlichkeit. Derartig reduzierte Wahrnehmungs- und Betrachtungsweisen
definieren Rassismus als triviales Problem. Dadurch wird seine gegenwärtige
gesellschaftspolitische Bedeutung marginalisiert und ghettoisiert. Indem
Rassismen von der Struktur der Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft
abgekoppelt betrachtet werden, bleiben ihre institutionellen Verankerungen
ausgeblendet. Einher geht damit die Mißachtung der sozialen Konsequenzen
von institutionellen Rassismen für MigrantInnen, Flüchtlinge
und Minderheiten. Diese Blickwinkel tragen zur Reproduktion und Festschreibung
von Rassismen bei.
Um institutionelle Rassismen (in Form von
staatlich regulierten Rassismen) ins Blickfeld zu rücken, plazierten
wir vom 14.10. - 27.11.1997 in der Wiener Innenstadt auf dem Herbert-von-Karajan-Platz
vor der Staatsoper ein 3 x 3 x 3 m großes Plakatobjekt.
Da dieser Platz von zahlreichen TouristInnen
besucht wird, zeigte das Plakatobjekt einen über eine fotografierte
Hausfassade gesetzten Text über die österreichische Schubhaftpraxis
in deutscher, englischer und italienischer Sprache. Diese Fassade ist Teil
eines Polizeigefangenenhauses an der Roßauerlände, eines der
beiden Wiener Schubhaftgefängnisse, in welchen über 50 Prozent
aller Schubhäftlinge in Österreich eingesperrt sind. Die vierte
Seite des Plakatobjekts informierte detaillierter, ebenfalls dreisprachig
unter der Headline „Wissenswertes über Österreich“ über
die Schubhaftpraxis in diesem Land.
Das Plakatobjekt war Teil des Projekts
INSTITUTIONELLE RASSISMEN, das als Ausstellung in der Kunsthalle Exnergasse
weitergeführt wurde. Dort wurde unter anderem ein Video mit leitenden
Beamten aus Österreich und Deutschland, die wir zu Abschiebehaft und
anderen Abschottungsmechanismen interviewt haben, gezeigt. Der Abteilungsleiter
für fremdenpolizeiliche Angelegenheiten im Innenministerium, Dr. Widermann,
und der Bundesasylamtschef von Österreich, Mag. Taucher, ein Ministerialdirigent
für Asyl- und Ausländerangelegenheiten, Dr. Lehnguth, und der
Ministerialdirektor des Bundesministerium des Inneren in Bonn, Dr. Rupprecht,
versuchen darin, ihre Tätigkeit und die staatlichen Abschottungspolitiken
zu rechtfertigen.
Ergänzend dazu lagen in der Ausstellung
ausgewählte Info-Materialien aus anti-rassistischen Publikationen
auf drei Holzpodesten in Form von seitlich geleimten Papierstapeln zur
freien Entnahme auf. Auf insgesamt 54 Seiten wird offensiv gegen verschiedene
Formen institutioneller Rassismen, unter anderem für eine sofortige
Abschaffung von Abschiebegefängnissen, eingetreten. Eine Kritik, die
nur unabhängige, radikale linke und daher eher auflagenschwache Zeitschriften
leisten.
Im Gegensatz dazu beschränkt sich
die Kritik in den meisten „liberalen“ Medien auf eine Berichterstattung
über die Bedingungen des Schubhaftvollzugs. Sie reduziert sich auf
in den Gefängnissen stattfindende Menschenrechtsverletzungen. Allerdings
wird nie die Abschaffung der Schubhaft gefordert, und die gesetzlichen
Bestimmungen und Praktiken, die den Umgang des österreichischen Staates
mit als „Ausländern“, „Wirtschaftsflüchtlingen“ oder „Illegalen“
etikettierten Menschen reglementieren, werden nie als rassistisch benannt.
Indem die Medien die Problematik nur anhand
von besonders krassen Einzelfällen thematisieren, bieten sie dem Staat
und seinen RepräsentantInnen die Möglichkeit, ein System der
rassistischen Ausgrenzung nach außen und innen zu verteidigen. Somit
können die wenigen bekannt gewordenen Mißstände von offizieller
Seite als Ausnahmen dargestellt werden. Das Versprechen, diese Mißstände
zu beheben, wird dann etwa von einer Betonung der Notwendigkeit der Abschiebepraxis
begleitet, wodurch zusätzliche Akzeptanz für die staatlich regulierten
Diskriminierungen von MigrantInnen geschaffen wird. So führt die oft
geäußerte Kritik an den Bedingungen in österreichischen
Schubhaftgefängnissen dazu, daß z.B. der Innenminister durch
die Einbeziehung diverser NGOs das Erscheinungsbild dieser Institution
verbessern möchte, um den Schubhaftvollzug, der letztlich die Abschiebung
garantieren soll, reibungsloser und effizienter zu gestalten.
Auch die rassistischen Polizeipraktiken,
Menschen mit dunkler Hautfarbe als potentielle DrogendealerInnen zu klassifizieren
und permanenten Polizeikontrollen zu unterziehen, werden von liberalen
Medien als notwendig hingenommen, außer bei unübersehbar rassistischen
Ereignissen (zum Beispiel wenn ein farbiger Regierungsbeamter aus Uganda
beim Trinken von Ananassaft im U-Bahnbereich als Drogendealer verdächtigt
und auf dem Polizeirevier mißhandelt wird). „Bestenfalls“ wird dann
das Verhalten der betreffenden PolizeibeamtInnen kritisiert, das System,
das solche rassistische Praktiken hervorbringt, bleibt wieder unangetastet.
Die auf „Einzelfälle“ beschränkte
Berichterstattung stärkt diese Mechanismen, bringt dadurch weitere
„Einzelfälle“ hervor, bis die Medien das Interesse daran verlieren.
Denn Schicksale, die einander zu sehr gleichen, verlieren an Sensationswert,
sie können Auflagen und Einschaltquoten nicht mehr steigern. „Das
interessiert die LeserInnen nicht mehr“, „wir haben eh schon sehr ausgiebig
darüber berichtet“ usw. konnten wir im Zuge unserer Arbeit immer wieder
von JournalistInnen und RedakteurInnen hören.
„Alle wirklich politisch verfolgten Menschen
genießen nach wie vor ein Asylrecht“ – diese oft benutzte Floskel
verdeckt, wie Österreich mit MigrantInnen wirklich umgeht: Denn das
Recht auf Asyl genießen nur all jene, die den flexibel (je nach wirtschaftlicher
und politischer Lage) festgesetzten Kriterien entsprechen - in Österreich
wurden 1996 von den 8732 Asylbewerbern nur 716 als Flüchtlinge anerkannt.
So gelten zum Beispiel (Bürger-)Kriegsflüchtlinge, die in ihren
Herkunftsländern den Militärdienst verweigern, nicht als politisch
verfolgt, obwohl die zwangweise Zurückschiebung in den Herkunftsstaat
für sie den Tod bedeuten kann. Denn, den Militärdienst zu verweigern,
gilt hierzulande nicht als politische Tat. Somit bleibt nur die Möglichkeit,
„illegal“ nach Österreich einzureisen. An der „grünen Grenze“
wartet dann bereits das österreichische Militär, das bestens
mit Nachtsichtgeräten und Hubschraubern ausgerüstet Jagd auf
sogenannte Illegale macht. Wenn dann als Ergebnis dieser Abschottungspolitiken
ein unbewaffneter Rumäne an der Grenze niedergeschossen wird, tauchen
höchstens den Vorfall beschreibende Meldungen in den Medien auf, ohne
daß dabei das Prinzip des bewaffneten Grenzschutzes grundsätzlich
in Frage gestellt wird.
Unsere Intention war es, dieser Berichterstattung,
die letztlich staatliche und alltägliche Rassismen stützt, entgegenzutreten.
Das Projekt setzte sich zum Ziel, institutionell und staatlich verankerte
Rassismen aufzuzeigen, indem zum Beispiel die Institution Schubhaft an
sich als rassistisch bezeichnet wurde. Rassismus kann klarerweise im Gegensatz
zu den in den Gefangenenhäusern vorherrschenden Bedingungen nicht
„verbessert“ oder „reformiert“ werden. Das Ziel muß die Abschaffung
der Institution Schubhaft sein.
Das bildete den Anlaß zu zahlreichen
Diskussionen vor dem Plakatobjekt und in den Medien. In der Live-Radiosendung
„Von Tag zu Tag“ in Ö1 diskutierten wir mit Peter Huemer und einigen
AnruferInnen darüber, ob und inwieweit der österreichische Staat
rassistisch handelt, wenn er Schubhaftgefängnisse aus Gründen
der Abschreckung und Abschottung betreibt. Natürlich reagierten auch
Printmedien auf diesen mittels des Plakatobjekts lancierten Vorwurf. Während
das Nachrichtenmagazin Profil noch die offene Frage stellte, wer denn hier
Rassist sei, attestierte der leitende Redakteur der neurechten Wochenzeitung
Zur Zeit in seinem mit „Staatlicher Rassismus“ betitelten Artikel dem Projekt
SOS-Mitmensch-Populismus und bedauerte, daß dadurch das Staatswesen
diskreditiert werde.
Diese und andere Kritiken beeinträchtigten
nicht unser Anliegen, die Inhalte des Projekts in die mediale Diskussion
einfließen zu lassen. Der Text des Plakatobjekts wurde in diversen
Printmedien abgedruckt oder in Radiosendungen vorgelesen (1), zudem war
das Projekt für einige JournalistInnen Anlaß zu Sendungen und
Artikeln über Schubhaft und Rassismus, für die sie mit uns persönlich
zusammentrafen (2).
In der Kunsthalle Exnergasse diskutierten
wir mit Schulklassen, die wir zu Ausstellungsgesprächen eingeladen
haben, über institutionelle Rassismen. Eine 8. Klasse des Wiener Gymnasiums
Hegelgasse wurde durch den Besuch der Ausstellung angeregt, das Thema im
(Deutsch-)Unterricht weiter zu bearbeiten. In einer von den SchülerInnen
ausgehenden Initiative wurden einige der anti-rassistischen Info-Texte
aus der Ausstellung weiter kopiert und in der ganzen Schule in den Klassen
verteilt. Zudem gestalteten SchülerInnen eine Litfaßsäule
mit den Texten.
Das Konzept von INSTITUTIONELLE RASSISMEN
wurde einige Male dahingehend kritisiert, daß wir in einem gewissen
Sinne selbst ausgrenzten, indem wir bei einem Projekt gegen Rassismen die
Positionen von anti-rassistischen MigrantInnen(gruppen) zu wenig hervorgehoben
hätten. Dieser teilweise berechtigten Kritik setzen wir entgegen,
daß das Projekt in erster Linie als Ergänzung zum antirassistischen
Widerstand von MigrantInnen und Antifas angelegt wurde. Das „Ausstellen“
antirassistischer MigrantInnen(-Initiativen) - mit der Begründung,
daß diese „direkt“ von Rassismen betroffen sind - führt leicht
dazu, daß MigrantInnen(gruppen) verstärkt für den Kampf
gegen Rassismen für zuständig erklärt werden, wodurch einmal
mehr Verantwortung delegiert werden kann. Schlimmstenfalls kann es bei
so einer Vorgehensweise passieren, daß Strategien, Ideen und Arbeitskraft
von MigrantInnen für ein anti-rassistisches Projekt benutzt werden,
aus dem dann ausschließlich die OrganisatorInnen kulturelles Kapital
abschöpfen. Auch das Konzept einer Vernetzung unterschiedlicher antirassistischer
(MigrantInnen-)Initiativen läßt die Frage offen, inwieweit diese
überhaupt auf solch eine Vernetzung angewiesen sind bzw. wer tatsächlich
im Falle des Gelingens davon profitiert. Obwohl (oder gerade weil) wir
über das Privileg einer österreichischen Staatsbürgerschaft
verfügen, halten wir es für notwendig, uns unter unserer Autorenschaft
als Kulturproduzenten den gesetzlich geregelten rassistischen Praktiken
des österreichischen Staates entgegenzustellen.
OLIVER RESSLER, MARTIN KRENN
(1) Auswahl der Medien, in welchen das
Plakatobjekt abgebildet und der Text des Plakatobjekt reproduziert wurde:
Willkommen Österreich, Markus Wailand,
Falter Nr. 42, 97
Meike Schmidt-Gleim, Falter Nr. 44, 97
Touristeninfo der anderen Art, Inlandsteil,
Der Standard, 14.10.97
Im Schengenland, Jochen Becker, TAZ -
Die Tageszeitung, 15/16.11.97
Institutionelle Rassismen, Tatblatt Nr.
18/97, Tatblatt Nr.19/97
Info-Intern (WUK), Titelblatt, Nr. 6/97
Institutionelle Rassismen, Christian Kravagna,
Springer - Hefte für Gegenwartskunst, Heft 4, 1997
Gegen staatlichen Rassismus, ak - analyse
und kritik, Nr. 407, 23.10.97
Wer ist hier Rassist? Christian Seiler,
Profil Nr. 42, 13.10.97
Von Tag zu Tag, Peter Huemer, Ö1,
12.11.97
Kulturjournal, Roland Schöny, Ö1,
23.10.97
Institutionelle Rassismen, Susanna Niedermayer,
FM4, 27.10.97
(2) Was heißt hier Illegale?, eine
Sendung über Schubhaft, Sonja Edler und Andreas Zinggl, ORF, 11.12.97
Institutionelle Rassismen, Aurelia Wunsch
und Christina Steinle, ORF, 12.11.97
Artikel über die österreichische
Schubhaftpraxis, Silke Rupprechtsberger, Die Furche, Dez. 97